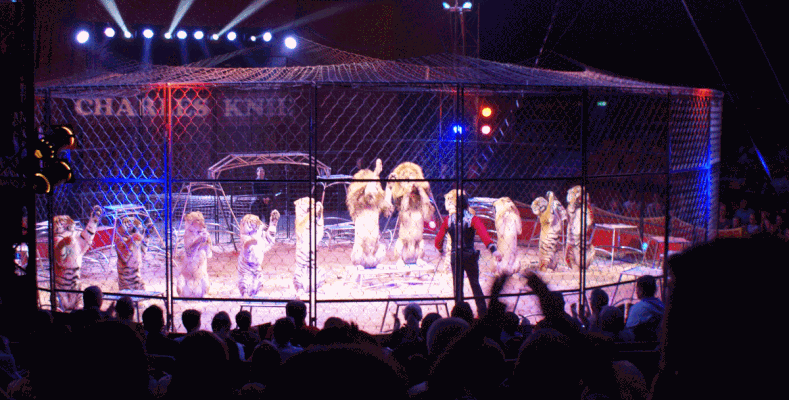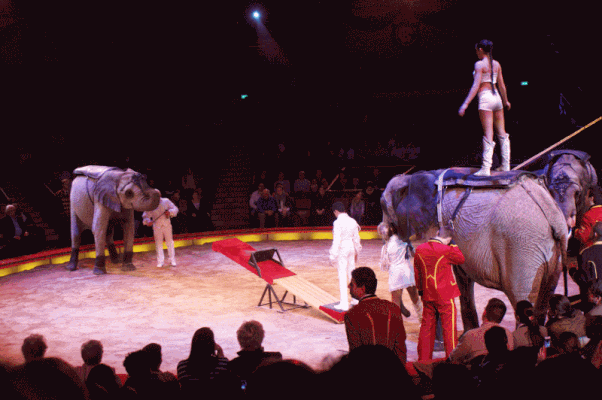Zur Dressur von Zirkustieren
mit Fotos aus den Jahren 2004-2019
Tierdressuren - wenigstens Pferde - gehören neben Akrobaten und Clowns zum klassischen Zirkus. Wenn sie gut gemacht sind, bringen sie ein ganz besonderes Flair ins Zelt: das staubende Sägemehl, der Geruch nach Tier und Stall, die großen Tiergestalten im Scheinwerferlicht, hautnah... all das verbinden nicht nur Kinder mit dem typischen Charakter einer Zirkusshow. Interessant zu beobachten ist das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch, das z.B. in Raubtiernummern zum Ausdruck kommt, wenn bestimmte Tiere ihre festen Plätze auf den Postamenten haben und mit persönlichen Gesten des Dompteurs angesprochen werden. Doch wie werden die Tiere dazu gebracht, im Kreis zu laufen, auf die Hinterbeine zu steigen oder sich auf ein Podest zu setzen? Was steckt hinter einer flüssig ablaufenden Dressur, die den Besuchern scheinbar mühelos präsentiert wird? - Auf dieser Seite werden in Kürze ein paar Grundlagen der Dressur vermittelt, wobei wir darauf hinweisen, dass die meisten hier gezeigten Tierarten heute nicht mehr in Zirkussen auftreten. Die Fotos auf dieser und den anderen Tierseiten sind überwiegend zwischen 2004 und 2015 entstanden und haben inzwischen teilweise mehr 'historischen' oder nostalgischen Wert.
An erster Stelle Geduld
Wer Tiere dressiert, muss sich vor allem in Geduld üben. Eine harmonische Dressurleistung ist meist das Ergebnis monate- oder jahrelanger Arbeit. Erstmal müssen die Tiere überhaupt an den Tierlehrer, an die Manege, die Musik und das Publikum gewöhnt werden. Erst wenn sie Vertrauen zu ihrer Umgebung gefasst haben, kann mit der eigentlichen Dressur begonnen werden. Nehmen wir z.B. einen Tiger, der von Podest zu Podest springen soll. Am Anfang stellt der Dompteur zwei Podeste dicht nebeneinander und legt auf das zweite ein Stück Fleisch. Der Tiger sieht das Fleisch und "wandert" von einem Postament zum anderen, um den Happen zu bekommen. Jetzt wird der Abstand zwischen den Podesten bei jedem Versuch vergrößert. Irgendwann muss der Tiger springen, um an das Fleisch zu gelangen. Wenn alles reibungslos funktioniert, stellt der Dompteur einen Reifen zwischen die Podeste. Der Tiger wird anfangs misstrauisch sein, nach einiger Gewöhnung aber auch durch den Reifen springen. Später kann das Fleischstück weggelassen werden. Wenn das Tier nach der Nummer eine richtige Mahlzeit bekommt, ist die Belohnung der einzelnen Tricks - zumindest in Form von Nahrung - nicht mehr nötig. Es reichen dann liebevolle Worte oder eine anerkennende Geste des Dompteurs.
Bilder: Die Lacey-Brüder aus England präsentieren preisgekrönte Raubtiernummern. - 1: Martin Lacey Jr., Chef des Circus Krone und 2-facher Goldgewinner in Monte Carlo, hier im Festbau in München mit seiner gefeierten Raubtiershow. - 2: Alexander Lacey mit Löwen und Tigern im Zirkus Charles Knie, nachdem er in den USA bei Ringling engagiert war.
Der Effekt positiver Verstärkung
Verantwortungsvolle Tierdresseure arbeiten beim Training vor allem mit positiver Verstärkung, mit anderen Worten: sie setzen in der Dressur auf Belohnung. Hat beispielsweise der Tiger (s. oben) gelernt, dass er immer ein Stück Fleisch bekommt, wenn er durch den Reifen springt, vollführt er diesen Sprung irgendwann in der Erwartung, dass es nachher etwas zu fressen gibt. Das vom Dresseur erwünschte Verhalten wird positiv verstärkt. Wenn sein Lehrer ihn hingegen mit Stockschlägen o.ä. zum Sprung zwingen würde (negative Verstärkung), würde der Tiger den Trick nur aus Angst vor Schmerzen ausführen und dadurch verkrampft wirken, ebenso wenn das Tier nach einem "verpatzten" Kunststück bestraft würde. In Dressuren, wo Strafe vor Belohnung steht, kann das Tier kein Vertrauen zu seinem Lehrer aufbauen. Deshalb werden Stockschläge, Peitschenhiebe und andere schmerzhafte Bestrafungsmethoden zumindest in den Zirkussen Westeuropas heute vermieden. Ausnahmen können sich in Notwehr-Situationen ergeben, wenn ein Tier unerwartet "durchdreht" und dem Dresseur gefährlich wird. Nicht restlos auszuschließen ist, dass es unter den Zirkussen hin und wieder 'Schwarze Schafe' gibt, die unlautere Dressurmethoden einsetzen. Gerade in Deutschland ist das Risiko aber sehr gering durch die strengen Kontrollen der Amtstierärzte (s. Tiere im Zirkus, Menü links). Ob dressierte Tiere schreckhaft wirken oder eher entspannt und routiniert, sieht man ihnen außerdem schon ohne besondere Fachkenntnis an.
Der Einsatz von Hilfsinstrumenten
Hilfsmittel wie Gerten, Stöcke und Führhaken werden gebraucht, um ein Tier in eine gewünschte Richtung zu lenken. Die Gerte - bekannt aus dem Reitsport und von Reiterhöfen - kann außer bei Pferden im Prinzip bei allen Huftieren und sogar bei Raubtieren als Dressurinstrument eingesetzt werden. Dasselbe gilt für den Handstock. Beide Hilfsmittel werden sowohl für optische Signale - ohne Berührung des Tieres - als auch für das so genannte Touchieren (urspr. französisch = Berühren) verwendet. Beim Touchieren wird das Tier mit der Gerte oder dem Stock mehr oder weniger kräftig berührt. Je nach Tierart und Situation kann das geschehen in Form von Antippen, Streifen, Stupsen, Klopfen oder leichtem Schlagen (wie ein "Klaps") - nur bis zu einem Grad, der nicht schmerzhaft ist! Das Tier soll den Reiz lediglich als lästig empfinden und ihm ausweichen, um sich z.B. zur Seite zu bewegen oder zu drehen. Wenn sich ein Pferd rechtsherum im Kreis drehen soll, touchiert der Dresseur das Tier mit der Gerte an der rechten Hinterflanke; unterstützend erteilt er mit lauter Stimme Befehle. Das Pferd weicht dem Reiz reflexartig aus und bewegt die Hinterläufe nach links, sein Körper dreht sich dabei nach rechts. Anschließend bekommt das Tier eine Belohnung in Form von "Leckerli" (ein Stück Zucker o.ä.), oder indem der Dresseur in liebevollem Tonfall zu ihm spricht und seine Nüstern krault.
Nach dem fünften, sechsten, zwanzigsten oder vielleicht hundertsten Versuch kapiert das Pferd instinktiv, dass es sich auf den Befehl des Dresseurs hin drehen soll. In menschliche Sprache übersetzt, dürfte im Kopf des Tieres ungefähr folgendes erlerntes Denkmuster ablaufen: "Aha! Jetzt ruft der Chef wieder laut, also soll ich mich drehen. Dann mach ich das mal, anschließend gibt's ja eine Belohnung." Die Gerte ist in diesem Stadium nur noch als Reserveinstrument zu gebrauchen, falls das Pferd bei der Vorführung aus irgendeinem Grund nicht auf Zurufe reagiert. Unterstützend für verbale Kommandos kann auch das Knallen der Peitsche (besser: Longierpeitsche) verwendet werden. Die Peitsche ist im Grunde eine verlängerte Variante der Gerte und ermöglicht es Dresseuren, aus einer gewissen Entfernung, etwa aus der Manegenmitte, durch sanftes Touchieren auf die Tiere einzuwirken oder durch Knallen akustische Befehle zu erteilen. Während die Gerte ca. 1,20 m und der Handstock bis zu 1,50 m lang sind, haben Peitschen einen 1,50 bis 1,80 m langen Stock, an den sich ein 2,50 bis 3,50 m langer lederner Schlag anschließt.
Bilder - 1: Großes Pferdekarussell im Schweizer Nationalcircus Knie. - 2: Die klassische Hohe Schule der Reiterei war in der frühen Phase des Neuzeit-Zirkus (18./19. Jh.) einer der Höhepunkt schlechthin. - 3: Kombinierte Dressur mit Pferden und Elefanten von der Familie René Casselly. - 4: Martin Lacey Jr. mit dem handzahmen Nashornbullen Tsavo im Circus Krone.
Bei der Pferdedressur werden im Probestadium meist Longen verwendet, ca. 8 m lange Leinen aus Nylon oder Baumwolle, die am Zaumzeug des Pferdes befestigt werden. Damit lassen sich die Tiere vom Dresseur, der die Longe führt, sicher und behutsam in die gewünschte Richtung bewegen. Hier wird im Gegensatz zum Touchieren nicht "geklopft", sondern "gezogen". Erfahrene Longenführer können die Steuerung der Bewegungsabläufe durch den Einsatz von Doppellongen noch verfeinern. Mit Hilfe des Longierens wird auch die Schwerpunktverlagerung auf eine Seite (rechts oder links) geübt. Wenn Zirkuspferde etwa beim Auftritt überwiegend links herum laufen, müssen sie zum Ausgleich auf der rechten Hand trainiert werden und umgekehrt.
Für die Dressur von Elefanten wird anstelle von Gerte und Handstock meist ein Führhaken verwendet, den man wegen seiner spezifischen Funktion auch "Elefantenhaken" nennt. Auf einem ca. 80 cm langen Stock sitzt ein Metallhaken. Die Spitze ist abgestumpft, damit den Elefanten keine Verletzungen zugefügt werden. Mit dem Führhaken kann der Dresseur an der weichen Haut hinter den Ohren ansetzen und den Elefant durch behutsames Ziehen in die gewünschte Richtung lenken. Außerdem wird der Führhaken zum Touchieren eingesetzt (s. oben). Übrigens geben auch in der Natur die Leittiere einer Elefantenherde ihren Artgenossen 'Kommandos' mit Hilfe der Stoßzähne. Es ist also durchaus normal für Zirkustiere, wenn der Dresseur als Autoritätsperson den Führhaken einsetzt.
Ergänzend zum Führhaken kommt bei der Elefantendressur die Peitsche zum Einsatz, wenn die Tiere aus einiger Entfernung dirigiert werden. Auch hier wird die Peitsche nicht zum Schlagen verwendet. Sehr gute Dresseure schaffen es nach längerem Training, die Elefanten nur auf Zuruf mit der Stimme zu dirigieren, sogar beim Übersteigen von liegenden Menschen. Solche Dressuren gehören zu den großen Momenten im klassischen Circus. Überhaupt spielt die Stimme des Dresseurs eine sehr wichtige Rolle neben allen manuellen Hilfsmitteln. Ein liebevoller, sanfter Ton schafft Vertrauen und unterstreicht die Belohnung; ein scharfer, lauter Befehlston dient als Kommando zur Durchführung eines Tricks. - Es ist im Übrigen interessant, dass einmal dressierte Zirkustiere den Bewegungsablauf ihrer Nummer so gut beherrschen, dass sie auch unter Anleitung eines neuen Trainers ihre Kunststücke aufführen können. Allerdings sollte die persönliche Beziehung zwischen dem Dresseur und "seinen" Tieren niemals unterschätzt werden. Die Dressur unter einem neuen Trainer ist meist erst nach einer Eingewöhnungsphase möglich und gelingt nicht in jedem Fall. Deshalb ist es immer von Vorteil, wenn ein Tierlehrer eine feste Tiergruppe hat, mit der er in der Manege arbeitet.
Bilder: Dressurleistungen der aus Deutschland stammenden Familie René Casselly. - 1: Auftakt zur Ponynummer mit vom Elefanten gezogenen Zigeunerwagen. - 2-4: Die in Monaco mit Gold prämierte Elefantendressur, hier im Circus Krone in München. Auf Bild 3 bereitet sich René Jr. auf den Schleudersprung zum Elefantenrücken vor, oben wartet seine Schwester.
Weiterentwicklung der Tierdressur
Die Dressur von Zirkustieren hat seit dem 19. Jahrhundert erhebliche Veränderungen durchlaufen. In der Zeit der Wandermenagerien und frühen Zirkusse wurden wilde Tiere einfach eingesperrt und mit brutalen Methoden zu Kunststücken gezwungen. Die Dompteure - oder "Bändiger", wie sie damals hießen - wurden Herr über die "wilden Bestien", indem sie ihnen Schmerzen zufügten. Tiger und Löwen beispielsweise wurden mit spitzen Eisenstäben und Brandfackeln gepiesackt, bis sie den Sprung durch den Reifen ausführten. Auch Tanzbären (im Mittelalter und heute noch in manchen Regionen der Erde) wurden bzw. werden mit derartigen Mitteln "gezähmt".
Einige Dompteure sahen schon damals ein, dass man auf die Art und Weise dem Tier nichts Gutes tat und die Qualität der Dressur darunter litt. Deshalb etablierte sich mit der Zeit die so genannte humane Tierdressur, als deren Erfinder häufig der Hamburger Tierfänger, Zirkus- und Zoodirektor Carl Hagenbeck genannt wird. Nach meinen Informationen sollen vor ihm schon andere Dompteure mit dieser Variante gearbeitet haben, doch Carl und vor allem sein Bruder Wilhelm Hagenbeck machten die humane Dressur erst wirklich bekannt. Die Tiere (die damals ja direkt aus der Wildbahn kamen) wurden nun zuerst gezähmt und an den Dresseur gewöhnt, bevor dieser ihnen Kunststücke beibrachte. Dadurch konnten die Tierlehrer viel besser auf den Charakter einzelner Tiere eingehen. Sie betrachteten ihre "Lehrlinge" fortan nicht bloß als Kreaturen, sondern als Individuen mit persönlichen Stärken und Schwächen.
Gute, moderne Dresseure setzen für einzelne Tricks nur Tiere ein, deren Charaktereigenschaften zum jeweiligen Kunststück passen. Der Tierlehrer kann sich eine angeborene "Macke" seines Schützlings zu Nutze machen und sie zu einem Dressurkunststück ausbauen. So kann ein von Natur aus träger Löwe in der Manege den Clown spielen, indem er immer nicht das tut, was der Dompteur von ihm erwartet. Heute verlangen verantwortungsvolle Dresseure ihren Tieren keine Bewegungen mehr ab, die dem natürlichen Verhalten der Art widersprächen. Man trifft in Europa nicht mehr auf Elefanten, die auf Dreirädern fahren, oder auf Bären und Affen in Menschenkleidern. Bei professioneller Dressur (und guter Unterbringung) genießen Zirkustiere manchmal Vorteile gegenüber Zootieren, da sie durch die Bewegung regelmäßig gefordert werden. Das Training in der Manege ist eine gute Gelegenheit, die Muskeln der Tiere zu stärken und ihre Gelenke geschmeidig zu halten. Gleichzeitig werden Reize aktiviert - beim Scheinkampf mit Raubkatzen z.B. der Spiel- und Beutetrieb der Tiere - sowie Langeweile vermieden.
Öffentlichkeitsarbeit
Vorbildliche Zirkusse bieten mitunter öffentliche Dressurproben an. Das Publikum kann dann bei Proben in der Manege oder auf dem Zirkusplatz zuschauen. Es ist ein begrüßenswerter Versuch, die Dressur in die Öffentlichkeit zu rücken und transparenter zu machen, damit Vorurteile abgebaut werden. Noch immer glauben nämlich viele Menschen - bzw. behaupten Tierrechtler -, dass Tiere im Zirkus nur unter Schmerzen und Qualen zu Kunststücken gezwungen würden. Sollte es mit Tieren im Zirkus überhaupt weitergehen, ist in Zukunft wohl noch mehr Öffentlichkeitsarbeit nötig, um mit Vorbehalten aufzuräumen. Freilich sind die Zirkusse auch gefordert, unter allen Umständen gute Voraussetzungen für die Haltung und Dressur ihrer Tiere zu gewährleisten. Leider hat das Thema in seriösen Medienberichten kaum einen Platz, sondern gerät fast immer auf negativen Druck von Tierrechtlern in die Öffentlichkeit (s. Tiere im Zirkus).
Bilder - 1-3: Öffentliche kommentierte Dressurproben im Schweizer Nationalcircus Knie, damals noch mit Elefanten (3). Es kommentierte der Baseler Zoodirektor, die Pferde(1+2) wurden von Fredy Knie Jr. dirigiert, einem der besten Pferdedresseure der Welt. - 4: Der Raubtierdompteur Martin Lacey Jr. (am Mikrofon) bei einer Pressekonferenz in seinem Circus Krone.